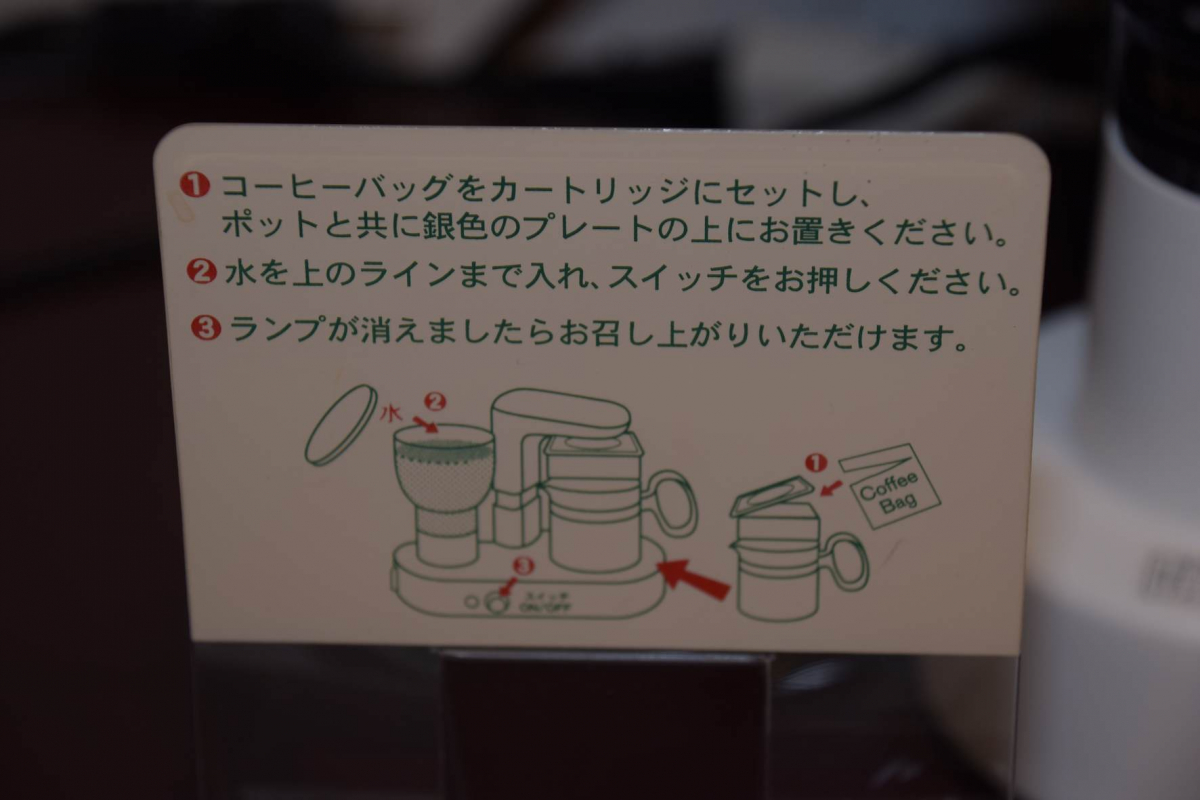

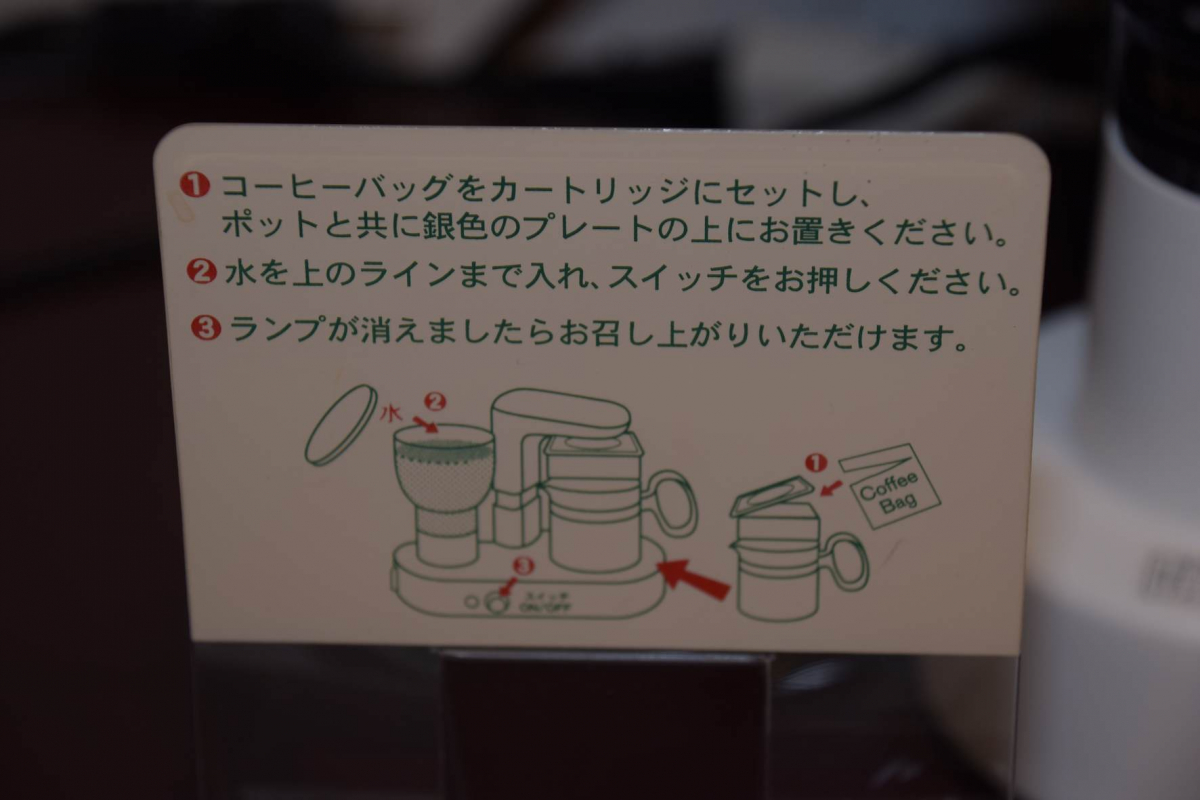

26.10.2017
Es war schon spät am Sonntagabend, kurz nach Mitternacht, in einer Lounge im Flughafen von Tokio. Alexander Wurz macht sich auf den Weg zum Flugsteig einer ANA-Maschine von Japan nach Frankfurt – zu einem kurzen Zwischenstopp in Europa nur, denn schon nach wenigen Tagen muss der Österreicher sich auf den Weg ans andere Ende der Welt machen, nach Austin und Mexiko-Stadt, zum Doppelschlag der Formel 1-WM in den Amerikas.
In diesen Wochen gehen die Uhren der Motorsport-Globetrotter mal wieder besonders schnell. Die Formel 1 war gerade in Japan, kurz drauf gastierte die Sportwagen-WM im asiatischen Inselstaat. Wurz muss bei beiden vor Ort sein – bei der Formel 1 als Ko-Kommentator des ORF und als Fahrercoach bei Williams, bei den Sportwagen als Berater vom Toyota-Werksteam.
Und an diesem späten Abend in der Lounge erzählt er mir allen Ernstes, er sei zwischen Grand Prix und Sechsstunden-Rennen der Sportwagen mal eben von Japan aus nach Hawaii geflogen. „Das ist gar nicht so weit – nur fünfeinhalb Stunden.“ Und ich antworte auch noch gedankenverloren: „Ach, das geht ja.“
Dabei sind knapp sechs Stunden Flugdauer in Wahrheit ein ziemlicher Schlauch. Doch die Reisen nach Japan, aber auch kommende Woche zur Sportwagen-WM nach Schanghai, dauern gerne mal 12 Stunden – da gerät das ganze Zeitgefühl aus den Fugen.
Das Schöne bei diesen Fernreisen ist: Man trifft an den entfernten Orten auf eine ganz andere Art der Motorsportbegeisterung als in Europa. Allein zwischen Japan und Mexiko liegen Welten: Im Fernen Osten gehören sogenannte „Superfans“ zum Alltagsbild im Fahrerlager; treue und glühende Bewunderer jeweils eines einzigen Fahrers, die ihrem Idol mit kleinen Geschenken zu jeder Rennstrecke nachreisen, die sie irgendwie erreichen können, und mit einer Engelsgeduld darauf warten, dass ihr Held aus der Box kommt und sich zwei bis vier Minuten Zeit für sie nimmt.
Die Fahrer sind sichtlich beeindruckt von dieser ganz besonderen Form der Verehrung. Japaner wie Kazuki Nakajima oder Kamui Kobayashi sind das gewohnt, doch für Europäer ist die Begegnung mit diesen Superfans stets eine Mischung aus Entgeisterung, Befremden und Erheiterung.
In Mexiko prallt die Formel 1 auf das andere Extrem: Die frenetische Begeisterung schlägt wie eine Welle über den Grand Prix-Piloten zusammen. Fanchorale wie in einem Fußballstadion sind die Norm, schließlich ist ein Teil der noch jungen Formel 1-Piste passender Weise in einem großen Baseballstadion gebaut worden. Die Zuschauer verkleiden sich in wilde Outfits, denn der Mexiko-Grand Prix fällt mit einem ganz besonderen Feiertag zusammen – eine Art Totensonntag, auf dem man allerdings nicht wie bei uns Trauer trägt, sondern sich mit Freudenfesten an die schönen und geselligen Stunden mit dem Verstorbenen erinnert.
In Japan stehen die Zuschauer bereits weit vor Einlass auf die Tribünen oder zur Autogrammstunde Schlange; fein säuberlich aufgereiht in Zweierreihen, akkurat hintereinander, geduldig und diszipliniert wartend. In Mexiko wird geschubst und gedrängelt, was das Zeug hält, um möglichst schnell möglichst nahe an die Idole ranzukommen.
Vor allem Sergio Pérez Mendoza ist besonders beliebt, ist er doch seit langer Zeit mal wieder der einzige halbwegs schnelle Mexikaner in der Formel 1. Wer mit Pérez schon mal zusammengearbeitet hat, ist an ihm allerdings recht schnell verzweifelt: Es gibt kaum einen Piloten, der aus seiner Grundschnelligkeit so wenig macht wie er. Weil Pérez sein Hirn nicht genug einsetzt und sich von der Begeisterung seiner Landsleute in falscher Arroganz wiegt.
Von der Grundschnelligkeit her hätte der Mittelamerikaner das Zeug, es in eine Liga mit Sebastian Vettel und Co. zu schaffen. Und er hat auch reiche Gönner und Förderer aus Mexiko hinter sich, die ihm immer wieder Cockpits in guten Teams auf verheißungsvollen Planstellen gemietet haben. Doch jedes Mal scheitert Pérez an sich selbst. Seine Zeit bei McLaren, zu der sich die Mitarbeiter des englischen Traditionsteams reihenweise entsetzt an den Kopf gegriffen haben, ist heute noch legendär im Fahrerlager.
Damals brauchte McLaren dringend das Geld aus Mexiko, weil die Scheidung vom langjährigen Werksmotorenpartner Mercedes gerade frisch war. Doch selbst dieser Notstand konnte das Team aus Woking nicht davon überzeugen, der Melkkuh Pérez eine zweite Chance zu geben. Das sagt schon alles über dessen Qualitäten.
Den Einheimischen ist das an diesem Wochenende völlig egal. Sie bejubeln den Ihren, als könne er – und nicht Vettel – Lewis Hamilton theoretisch noch den WM-Titel entreißen. In den meisten europäischen Ländern hätten die Fans ihre Loyalität längst aufgekündigt; die Pfeifkonzerte in Fußballstadien sprechen eine deutliche Sprache. Die Mexikaner hingegen vollen ihren Helden feiern, auch wenn er nichts reißt.
An so eine Begeisterung bei bestenfalls mäßigen Resultaten kann ich mir nur noch in einem Fall erinnern, er liegt etwa 10 Jahre zurück – als Takuma Sato in einem von Landsmann Aguri Suzuki privat eingesetzten Honda beim Großen Preis von Japan überraschend in die mittleren Punkteränge fuhr.
Da gaben selbst die Japaner ihre Zurückhaltung auf und kreischten wie bei der Ankunft der Beatles in Nippon. Allerdings ohne dabei gänzlich ihre Contenance zu verlieren.